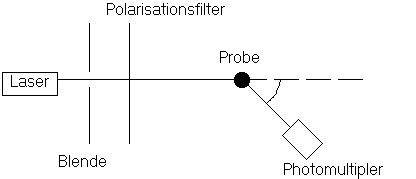
Probe 1: Rayleigh-Streuung
Probe 2: Mie-Streuung
Mit Hilfe der Streuung von elektromagnetischer Strahlung kann man den Aufbau der Materie untersuchen. In unserem Versuch werden wir monochromatisches, polarisiertes Licht an verschiedenen Proben streuen und mit Hilfe eines Photomultiplers die Intensität der gestreuten Strahlung in Abhängigkeit vom Streuwinkel und der Polarisation des einfallenden Lichts messen.
Dabei können zwei Arten von Streuung auftreten, die Rayleigh-Streuung und die Mie-Streuung.
Rayleigh-Streuung entsteht dadurch, daß eine elektromagnetische Welle auf ein Atom trifft und den Kern ein wenig in Richtung des E-Feldes und die Elektronen entgegengesetzt dazu verschiebt. So entsteht ein strahlender, elektrischer Dipol, der mit der gleichen Frequenz wie die Welle schwingt.
Das Rayleighsche Streugesetz ist nur gültig wenn die Größe der Atome oder Moleküle solange gilt: D/l > 0,1 ,da die Teilchen die den Dipol bilden sonst nicht mehr in Phase schwingen. Gilt D/l > 0,1 , dann können die einzelnen atomaren Dipole auch destruktiv miteinander interferieren. Hier gilt nun die Mie-Streuung, bei der die Form und die Größe der Teilchen berücksichtigt werden.
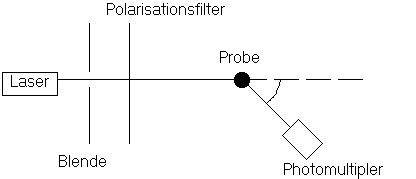
Bei dieser Probe sind die Teilchen so klein, daß die Bedingungen für die Rayleigh-Streuung näherungsweise erfüllt sind.
Beim Eintragen der Werte für  in das
Polarkoordinatensystem müßte sich nach der Theorie ein Kreis ergeben. Daß sich
der Radius des Kreises zu größeren Winkeln hin verkleinert ist wohl darauf
zurückzuführen, daß schon etwas Mie-Streuung
aufgrund der Teilchengröße auftritt. Auf die Abflachung des Kreises zu 90° hin
wird in Abschnitt 4 noch näher eingegangen.
in das
Polarkoordinatensystem müßte sich nach der Theorie ein Kreis ergeben. Daß sich
der Radius des Kreises zu größeren Winkeln hin verkleinert ist wohl darauf
zurückzuführen, daß schon etwas Mie-Streuung
aufgrund der Teilchengröße auftritt. Auf die Abflachung des Kreises zu 90° hin
wird in Abschnitt 4 noch näher eingegangen.
Der Effekt der Mie-Streuung verfälscht auch das erwartete Meßergebnis von  .
Die beiden Keulen sollten nach der Theorie gleich groß sein. Durch die auch destruktive Rückwertsstreuung der Mie-Streuung wird
jedoch die Keule mit den größeren Winkeln kleiner.
.
Die beiden Keulen sollten nach der Theorie gleich groß sein. Durch die auch destruktive Rückwertsstreuung der Mie-Streuung wird
jedoch die Keule mit den größeren Winkeln kleiner.
Zu den Meßfehlern ist zu sagen, daß die Apparatur sehr empfindlich auf Außeneinflüße reagierte. Es lagen Stromschwankungen vor, die ein genaues Ablesen der Meßwerte erschwerte. Fremdlicht, Reflexionen und Mehrfachstreuung an den Teilchen bei hoher Konzentration verfälschten die Meßwerte zusätzlich.
Es ist anzunehmen, daß der systematische Fehler den statistischen Fehler bei weitem übertrifft.
Bei dieser Probe sind die Teilchen so groß, daß Mie-Streuung beobachtet werden kann.
Berechnung des Asymmetriefaktors für  bzw.
bzw. 
Für den Asymmetriefaktor x gilt:
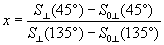
x1=2,79
(Erwarteter Wert 1, evtl falsch befüllte Probe? (zu große Teilchen?))
x2=3,13
Wellenlänge des Lasers in Wasser:
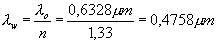
Durch lineare Interpolation folgt aus Tabelle1:
für x1=2,79 ist
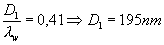
für x2=3,13 ist
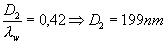
Für den Polarisationsgrad P bei 90° gilt:
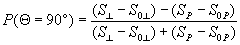
Probe 1: P1=0,53
Daß der experimentell ermittelte Polarisationsgrad kleiner als eins ist kann nicht von einer unvollständigen Polarisation des Lasers kommen, da bei der Messung für Probe 1 bei =20° bei der Stellung 45° der Strom gleich Null, bei einer Stellung von -45° der Strom maximal war.
Eher spielten bei der Verfälschung der Meßwerte die beiden Lampen eine Rolle die zum Ablesen der Amperemeter benötigt wurden, das heißt, daß der Fehler durch die Meßapparatur bedingt war. Das Streulicht dieser Lampen fiel nämlich bei =30° immer genau in, bei =150° aber auf die Rückseite des Photomultiplers. Dies würde auch erklären, daß die Meß- werte bei =150° immer deutlich unter den erwarteten Werten lagen.
Da die Moleküle im Analysator parallel zur Schwingungsebene des einfallenden Lichtes ausgerichtet sind, ergibt sich dahinter destruktive Interferenz. Daraus folgt, daß die Streunintensität Null wird.
Es tritt hier nicht nur Rayleigh-Streuung auf, daher ist auch „anders“ polarisiertes Licht nach der Streuung detektierbar.
Bei einer Verringerung der Teilchenkonzentration verringert sich die Wahrscheinlichkeit für Mehrfachstreuung, die Bestimmung des Teilchendurchmessers wird präziser.
Der Versuch kann auch mit anderen Lichtquellen anstelle eines Lasers durchgeführt werden, z.B. für Wellenlängen im Mikrowellenbereich (Nachweis größerer Teilchen): Maser. (Kohärenz etc. der „Lichtquelle“ sollte jedoch gegeben sein)
Die Blaufärbung unseres Himmels beruht auf Streuprozessen des Sonnenlichts an den Teilchen der Atmosphäre. Morgen- und Abendrot entstehen hingegen durch Brechungseffekte (Dispersionsrelation).